Gesetzesredaktion: Studien zur Textlinguistik der Rechtsetzung
Stefan Höfler
Seiteninhalt
I. Einleitung
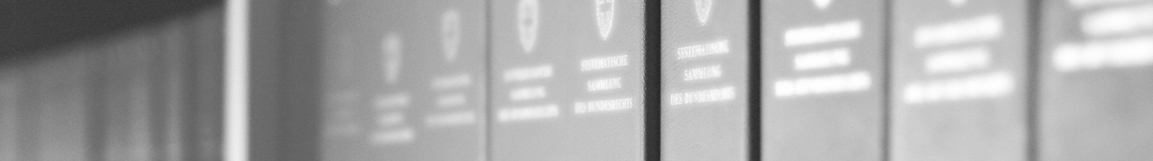
II. Überblick
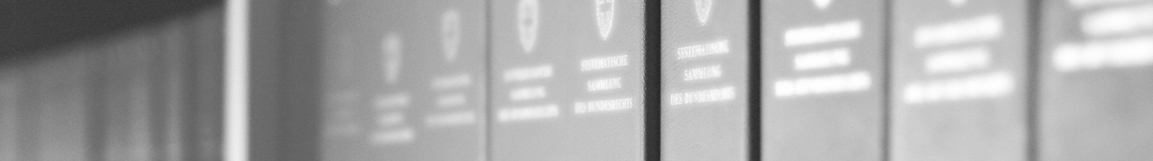
Die Sprache des Gesetzes soll verständlich sein
Die Schweiz hat seit den Anfängen des modernen Bundesstaats versucht, ihre Gesetze in vergleichsweise einfacher und klarer Sprache zu formulieren. Dafür gibt es demokratiepolitische, rechtsstaatlicheund wirtschaftliche Gründe. Der Beitrag gibt einen einführenden Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit an der Verständlichkeit von Gesetzestexten.
Höfler, Stefan (2019): Die Sprache des Gesetzes soll verständlich sein. In: Plädoyer 36(4):42–46.
Making the Law More Transparent: Text Linguistics for Legislative Drafting
An increasingly globalised and digitalised legal environment creates additional pressure for legislative texts to be drafted in a clear and transparent way. In this chapter, I argue that text linguistics can make a valuable contribution to how this goal can be achieved. To substantiate this argument, I provide specific examples from legislative drafting in Switzerland. I show how the concepts and methods of text linguistics can help drafters identify and remedy impediments to the transparency of statutes and regulations at a functional, thematic and propositional level of textual structure. I conclude the chapter with a summary of the challenges that lie ahead and the solutions I believe we need to devise to maintain the transparency of the law in a globalised world.
Gute Gesetzessprache aus dem Blickwinkel der Sprachwissenschaft: Rechtsetzung im Lichte linguistischer Verstehens- und Verständlichkeitsforschung
Im vorliegenden Beitrag wird gefragt, inwiefern die Erkenntnisse der linguistischen Verstehens- und Verständlichkeitsforschung die Gesetzesredaktion bei der Erfüllung ihrer Aufgabe unterstützen können. Grundlegend ist dabei die Beobachtung, dass am Verstehensprozess immer mehrere Sprachebenen beteiligt sind: Wer einen Text verstehen will, muss nicht nur die verwendeten Wörter und Sätze erfassen, sondern auch die zum Ausdruck gebrachten inhaltlichen Zusammenhänge erkennen und die kommunikativen Absichten begreifen, die der Text verfolgt. Entsprechend muss auch die Arbeit an der Verständlichkeit von Gesetzestexten auf mehreren Ebenen ansetzen. Im Beitrag wird besprochen, was dies für die Gesetzesredaktion im Einzelnen bedeutet.
Zur Diskursstruktur von Gesetzestexten: Satzübergreifende Bezüge als Problem der Gesetzesredaktionten
Rechtssätze können letztlich nur verstanden werden, wenn nachvollziehbar ist, wie sie an den Diskurs anknüpfen. Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, was diese These für die Gesetzesredaktion bedeutet: Wie kann und soll die Einbettung eines Rechtssatzes in den Diskurs bei der Redaktion von Gesetzestexten sprachlich zum Ausdruck gebracht werden? Mit welchen sprachlichen Mitteln können die Leserinnen und Leser von Gesetzen dabei unterstützt werden, die Diskursstruktur von Gesetzestexten zu erfassen? Zur Beantwortung dieser Fragen werden textlinguistische Analysemodelle auf die Eigenheiten von Gesetzestexten angewendet. Zunächst wird erörtert, inwiefern Gesetzestexte aus textlinguistischer Sicht überhaupt als Diskurse betrachtet werden können. Anschließend wird analysiert, auf welche Weise die Diskursstruktur von Gesetzestexten transparent gemacht werden kann und welche Verstehenshindernisse entstehen können, wenn dies nur ungenügend geschieht. Die angestellten Überlegungen werden anhand von Beispielen aus der Bundesgesetzgebung der Schweiz und aus der Praxis der Redaktionskommission der schweizerischen Bundesverwaltung veranschaulicht.
III. Einzelfragen
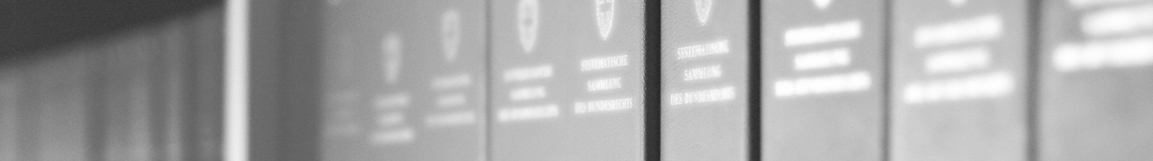
Müssen oder nicht müssen? Die Modalität von Rechtssätzen aus redaktioneller Sicht
Dieser Beitrag geht der Frage nach, ob und wann der Pflichtcharakter eines Rechtssatzes sprachlich explizit gemacht werden soll (z. B. mit dem Modalverb müssen) und unter welchen Umständen er implizit bleiben kann. Anhand von rechts- und sprachtheorischen Überlegungen wird gezeigt, dass die explizite Modalisierung von Rechtssätzen vor allem zwei Zwecken dient: einer adressatengerechten Perspektivierung und der Unterscheidung unterschiedlicher Normtypen. Wenn sie richtig eingesetzt wird, kann eine explizite Modalisierung von Rechtssätzen zu einer klareren und bürgerfreundlicheren Gesetzessprache beitragen.
Die Informationsstruktur von Rechtssätzen und ihre Bedeutung für die Gesetzesredaktion
Gesetzesredaktionelle Faustregeln, die mit der Wortstellung von Rechtssätzen befasst sind, orientieren sich meist an der logischen Struktur, die diesen Sätzen zugrunde liegt, insbesondere an der aus der Rechtstheorie bekannten Gliederung in Tatbestand und Rechtsfolge. Während dieser Ansatz bei der Formulierung von Rechtssätzen wertvolle Hilfestellung bieten kann, lässt er doch wichtige Aspekte der Satzverständlichkeit unbeachtet; entsprechend häufig werden die erwähnten Faustregeln in der Gesetzesredaktion durchbrochen. Im vorliegenden Beitrag wird deshalb vorgeschlagen, den klassischen rechtstheoretischen Blick auf Rechtssätze um eine textlinguistische Komponente zu ergänzen: Eine Rechtssatzlehre, die nicht nur den Bedürfnissen der Rechtsanwendung, sondern auch jenen der Rechtsetzung genügen kann, sollte neben der logischen auch die kommunikative Struktur dieser Sätze, die sogenannte Informationsstruktur, berücksichtigen.
«Ein Artikel – eine Norm». Redaktionelle Überlegungen zur Diskursstruktur von Gesetzesartikeln
Der Artikel ist die grundlegende Gliederungseinheit in Erlassen. Seine zentrale Rolle ergibt sich insbesondere daraus, dass er die Form ist, in der eine einzelne Norm
sprachlich realisiert wird. Dieser Beitrag befasst sich damit, welche redaktionellen Anforderungen an den inneren Aufbau (die Diskursstruktur) von Gesetzesartikeln sich aus dieser Funktion ableiten lassen, und er zeigt auf, wie anhand der Diskursstruktur Artikel identifiziert werden können, die mehr als eine Norm enthalten. Der Beitrag verbindet zu diesem Zweck eine rechtstheoretische Betrachtungsweise mit einem textlinguistischen Beschreibungsansatz.
«Ein Satz – eine Aussage». Multipropositionale Rechtssätze an der Sprache erkennen
Dieser Beitrag befasst sich mit der gesetzesredaktionellen Regel, dass ein Satz nicht mehr als eine Aussage enthalten soll. Sätze, die diese Regel verletzen, sind oft nicht auf Anhieb als solche erkennbar. Der Beitrag untersucht darum, welche sprachlichen Indikatoren darauf hinweisen, dass in einem Satz möglicherweise mehr als eine Aussage vorhanden ist. Er zeigt dabei auf, dass die Regel «Ein Satz – eine Aussage», wenn sie richtig angewendet wird, wesentlich zur Transparenz und Lesbarkeit von Gesetzestexten beitragen kann.
Between Conciseness and Transparency: Presuppositions in Legislative Texts
Presupposition is the semantic-pragmatic phenomenon whereby a statement contains an implicit precondition that must be taken for granted (presupposed) for that statement to be felicitous. This article discusses the role of presupposition in legislative texts, using examples from Swiss constitutional and administrative law. It illustrates (a) how presuppositions are triggered in these texts and (b) what functions they come to serve, placing special emphasis on their constitutive power. It also demonstrates (c) how legislative drafters can distinguish between “good” presuppositions and “bad” presuppositions by weighing their main advantage, conciseness, against their main flaw, reduced transparency. The present study argues that, if employed carefully, presuppositions can be a useful stylistic means to keep legislative texts free from unnecessary clutter that merely elaborates on the obvious; however, it also suggests that, if applied wrongly, presuppositions can camouflage the duties and obligations placed on the subjects of a law and thus impede its accessibility and its efficient and effective implementation.
Die Redaktion von Verweisen unter dem Aspekt der Verständlichkeit
Ausdrückliche Verweise auf andere Artikel oder Absätze sind in moderneren Erlasstexten beinahe allgegenwärtig. Im vorliegenden Beitrag wird die Redaktion von Verweisen unter dem Gesichtspunkt der Verständlichkeit betrachtet: Es wird gefragt, welche Konsequenzen die Forderung nach einer knappen, einfachen und präzisen Erlasssprache für die Formulierung von Verweisen hat und welche sprachlich-redaktionellen Kriterien sich daraus ableiten lassen. Der Beitrag verbindet zu diesem Zweck typische Fragestellungen der Rechtsetzungslehre mit Konzepten und Erkenntnissen aus der Textlinguistik.
Das Legalitätsprinzip in der Gesetzessprache
Im vorliegenden Beitrag wird die juristische Anforderung der genügenden gesetzlichen Grundlage mithilfe sprachwissenschaftlicher Beschreibungsansätze für die Praxis der Gesetzesredaktion konkretisiert. Zu diesem Zweck wird zunächst das Zusammenspiel zwischen den zwei beteiligten Rechtsetzungsprinzipien geklärt, also zwischen dem Legalitätsprinzip einerseits (staatliches Handeln muss eine genügende gesetzliche Grundlage haben) und dem Verständlichkeitsgebot andererseits (Gesetzestexte müssen verständlich sein). Anschliessend wird gefragt, wie sich Verletzungen des Legalitätsprinzips in der Gesetzessprache manifestieren können. Dazu werden neuralgische sprachliche Konstruktionen identifiziert, die der Gesetzesredaktor oder die Gesetzesredaktorin einer sorgfältigen Prüfung unterziehen sollte, weil sie im ungünstigsten Fall zu einer ungenügenden gesetzlichen Grundlage führen können.
Symoblische Gesetze und ihre Funktionen
Empathie ist in der Rechtsetzung nicht nur nicht gefragt, sondern auch ausdrücklich nicht erwünscht. Dennoch enthalten Gesetzestexte regelmässig Elemente, die keine normative Wirkung entfalten, sondern vielmehr zum Zweck haben, eine emotionale Verbindung zu den Adressatinnen und Adressaten herzustellen. Diese Elemente werden üblicherweise unter dem Begriff der symbolischen Gesetzgebung zusammengefasst. Sie stehen im Fokus des vorliegenden Kapitels.
IV. Sonderfälle
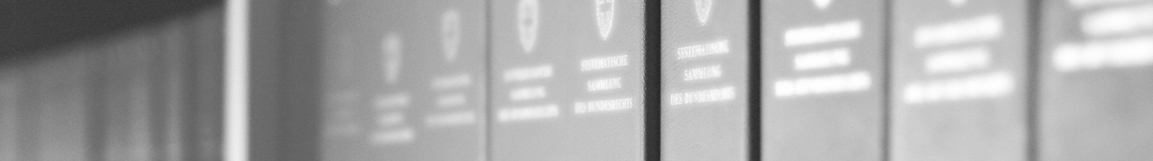
Rechtsetzung im Mehrebenensystem: Redaktionelle Aspekte
Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, was die Forderung nach verständlichen Gesetzestexten für die Redaktion von Erlassen bedeutet, die übergeordnetes Recht konkretisieren: Worauf muss man achten, wenn man erreichen will, dass diese besonderen Texte sachgerecht, klar und bürgerfreundlich formuliert sind? Der Beitrag bietet zunächst einen Überblick über die verschiedenen Arten von Intertextualität, die bei Erlassen vorkommen. Anschliessend wird diskutiert, welche spezifischen redaktionellen Probleme sich bei der Formulierung von Erlassen ergeben, die übergeordnetes Recht konkretisieren, und welche Strategien der Gesetzesredaktion zur Verfügung stehen, um diesen Problemen zu begegnen.
Notrecht als Krisenkommunikation? Redaktionelle Fallgruben
Notrecht stellt die Gesetzesredaktion vor eine doppelte Herausforderung: Einerseits besteht nur wenig Zeit, um an der Formulierung der einzelnen Bestimmungen zu arbeiten, und andrerseits bestehen gerade bei diesen Erlassen gesteigerte Anforderungen an die Verständlichkeit. Die Bedingungen, unter denen Notrecht entsteht, haben zudem zur Folge, dass es besonders anfällig ist für eine Reihe gesetzesredaktioneller Fallgruben. Diese Fallgruben werden im folgenden Beitrag anhand von Beispielen aus der COVID-19-Verordnung 2 diskutiert. Dabei zeigt sich, dass Notrecht in einem besonderen Spannungsverhältnis zur behördlichen Krisenkommunikation steht: Notrecht und Krisen kommunikation können sich ergänzen oder aber gegenseitig sabotieren. Deshalb ist eine sorgfältige Gesetzesredaktion auch in Krisenzeiten unerlässlich.
Der «Monster-Paragraf» – wie (un-)verständlich ist er wirklich?
Artikel 8 Absatz 3 des Zweitwohnungsgesetzes gab zu reden: In verschiedenen Medien wurde er als Beispiel einer besonders unverständlichen Gesetzesbestimmung herumgereicht (Stichwort: «Monster-Paragraf»), und es wurden verschiedene Verbesserungsvorschläge gemacht. Aber wie (un-)verständlich ist die Gesetzesbestimmung tatsächlich? Das Zentrum für Rechtsetzungslehre der Universität Zürich hat versucht, diese Frage auf neuem Weg zu beantworten: In einem Experiment, an dem 123 Master-Studierende der Rechtswissenschaftlichen Fakultät teilgenommen haben, hat es die Verständlichkeit des «Monster-Paragrafen» und von zwei Verbesserungsvorschlägen getestet. Der vorliegende Beitrag stellt die Ergebnisse des Experiments vor. Er zeigt unter anderem, dass es selbst bei einer vermeintlich präzisen Gesetzesbestimmung nicht nur eine Art von Verständlichkeit gibt.
V. Verfahren
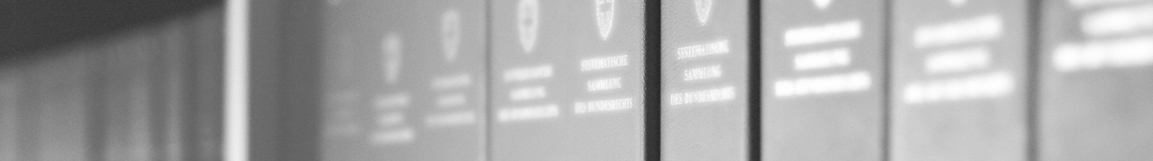
Legislation in Switzerland
Switzerland has a multilingual, multi-layered civil-law system. Its current legal system was established in 1848, when the modern Swiss state was founded, and has been further developed ever since. Swiss legislation has come to be shaped by three basic constitutional tenets: federalism, direct democracy and separation of powers. In this chapter, we analyse the unique political necessities and legislative traditions that these tenets have created.
Legislative drafting
Legislative drafting is the process whereby the conceptualisation of a new legislation is transformed into an actual legislative text. This process can be broken down into several, potentially repeated stages (planning, composing, revising, editing) and involves a range of actors with different skills (policy makers and domain experts, drafting specialists and language experts, translators). We argue that the way in which the drafting process is organised can have a substantial impact on the quality of the product. For this reason, we first discuss the requirements that each stage of the drafting process must meet in order to facilitate the production of high-quality legislative texts. We then introduce the major models by which the drafting process has been organised — in civil law and common law countries as well as in multilingual jurisdictions — and we identify their respective strengths and weaknesses.
Gute Gesetzessprache aus dem Blickwinkel der Verwaltung: Die Redaktionskommission der schweizerischen Bundesverwaltung
Im vorliegenden Beitrag wird die verwaltungsinterne Redaktionskommission des Bundes und ihre Arbeit an der guten Gesetzessprache unter die Lupe genommen. In einem ersten Teil werden die Rechtsgrundlagen dargestellt, auf die sich die Arbeit der verwaltungsinternen Redaktionskommission stützt. Danach werden die Organisation, der Auftrag und das Verfahren der Kommission besprochen. Und schliesslich werden die Stärken und Schwächen bzw. die Möglichkeiten und Grenzen einer Verständlichkeitskontrolle diskutiert, wie sie der Bund mit dieser Kommission in seinem verwaltungsinternen Rechtsetzungsverfahren eingerichtet hat.
Professional legislative drafters – New ideas for Switzerland?
In this chapter, we compare the Swiss system of legislative drafting with models of legislative drafting that are radically different, viz. the models employed in Australia, Canada, the Netherlands, Poland, the United Kingdom and the United States. What distinguishes these latter models from the Swiss system is that they all include, in one form or another, the concept of professional legislative drafters. We discuss the roles that professional drafters have come to play in these models and the influence they exert on the final product, and we look at the ways in which the education of these persons has been organised. We then compare these models with how legislative drafting, and the training of persons involved in it, has been done in Switzerland and reflect on the impact that the experiences made in other countries could or should have on the Swiss system.
Multilingual Legislative Drafting in Swiss Cantons: Burden or Blessing?
This article is about drafting multilingual legislative texts in three cantons of Switzerland that have German and French as their official languages and a fourth canton that has German, Italian and Romansh as its official languages. Three drafting models are variously used in these cantons: co-drafting, co-revision and co-editing. The article describes each of these models and assesses their effects both in terms of the volume (quantity) and the quality of legislation produced.
VI. Werkzeuge
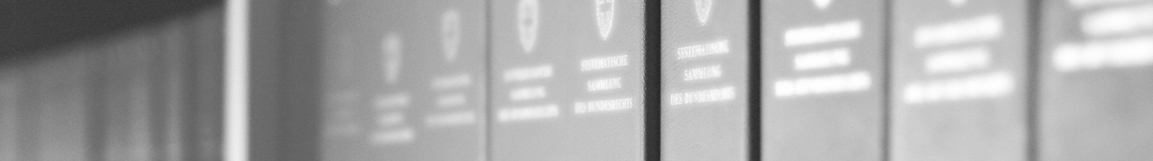
Legislative Drafting Guidelines: How Different Are They from Controlled Language Rules for Technical Writing?
While human-oriented controlled languages developed and applied in the domain of technical documentation have received considerable attention, language control exerted in the process of legislative drafting has, until recently, gone relatively unnoticed by the controlled language community. This paper considers existing legislative drafting guidelines from the perspective of controlled language. It presents the results of a qualitative comparison of the rule sets of four German-language legislative drafting guidelines from Austria, Germany and Switzerland with a representative collection of controlled language rules published by the German Professional Association for Technical Communication. The analysis determines the extent to which the respective rule sets control the same or similar aspects of language use and identifies the main differences between legislative drafting guidelines and controlled language rules for technical writing.
Constructing and Exploiting an Automatically Annotated Resource of Legislative Texts
In this paper, we report on the construction of a resource of Swiss legislative texts that is automatically annotated with structural, morphosyntactic and content-related information, and we discuss the exploitation of this resource for the purposes of legislative drafting, legal linguistics and translation and for the evaluation of legislation. Our resource is based on the classified compilation of Swiss federal legislation. All texts contained in the classified compilation exist in German, French and Italian, some of them are also available in Romansh and English. Our resource is currently being exploited (a) as a testing environment for developing methods of automated style checking for legislative drafts, (b) as the basis of a statistical multilingual word concordance, and (c) for the empirical evaluation of legislation. The paper describes the domain- and language specific procedures that we have implemented to provide the automatic annotations needed for these applications.
From Drafting Guideline to Error Detection: Automating Style Checking for Legislative Texts
This paper reports on the development of methods for the automated detection of violations of style guidelines for legislative texts, and their implementation in a prototypical tool. To this aim, the approach of error modelling employed in automated style checkers for technical writing is enhanced to meet the requirements of legislative editing. The paper identifies and discusses the two main sets of challenges that have to be tackled in this process: (i) the provision of domain-specific NLP methods for legislative drafts, and (ii) the concretisation of guidelines for legislative drafting so that they can be assessed by machine. The project focuses on German-language legislative drafting in Switzerland.
Building Corpora for the Philological Study of Swiss Legal Texts
We describe the construction of two corpora in the domain of Swiss legal texts: The DS21 corpus is based on the Collection of Swiss Law Sources and contains historical legal texts from the early Middle Ages up to 1798; the Swiss Legislation Corpus (SLC) is based on the Classified Compilation of Swiss Federal Legislation and contains all current Swiss federal laws. The paper summarizes the key properties of both corpora, discusses issues encountered while building them, and outlines some applications.
Designing a Controlled Natural Language for the Representation of Legal Norms
Controlled Legal German (CLG) is a controlled natural language being developed for the representation of legal norms contained in Swiss statutes and regulations. This paper discusses the main design requirements CLG faces and the strategies it applies to meet them. CLG aims at providing representations for legal norms that are both formal and can be easily understood and veried by legal experts. It must combine an unambiguous semantics based on FOL and deontic concepts with close syntactic proximity to conventional legal language.
Controlling the Language of Statutes and Regulations for Semantic Processing
Controlled Legal German (CLG) is a subset of legal German specifically designed to facilitate the semantic processing of Swiss statutes and regulations. In this paper, we describe the strategies CLG employs to reduce ambiguity and underspecification in such texts, and the methods it uses to maintain proximity to conventional legal language. The presented discussion suggests that, if existing synergies are properly exploited, the concept of controlled natural language can be of benefit to the semantic processing of legal texts as well as to legislative drafting.